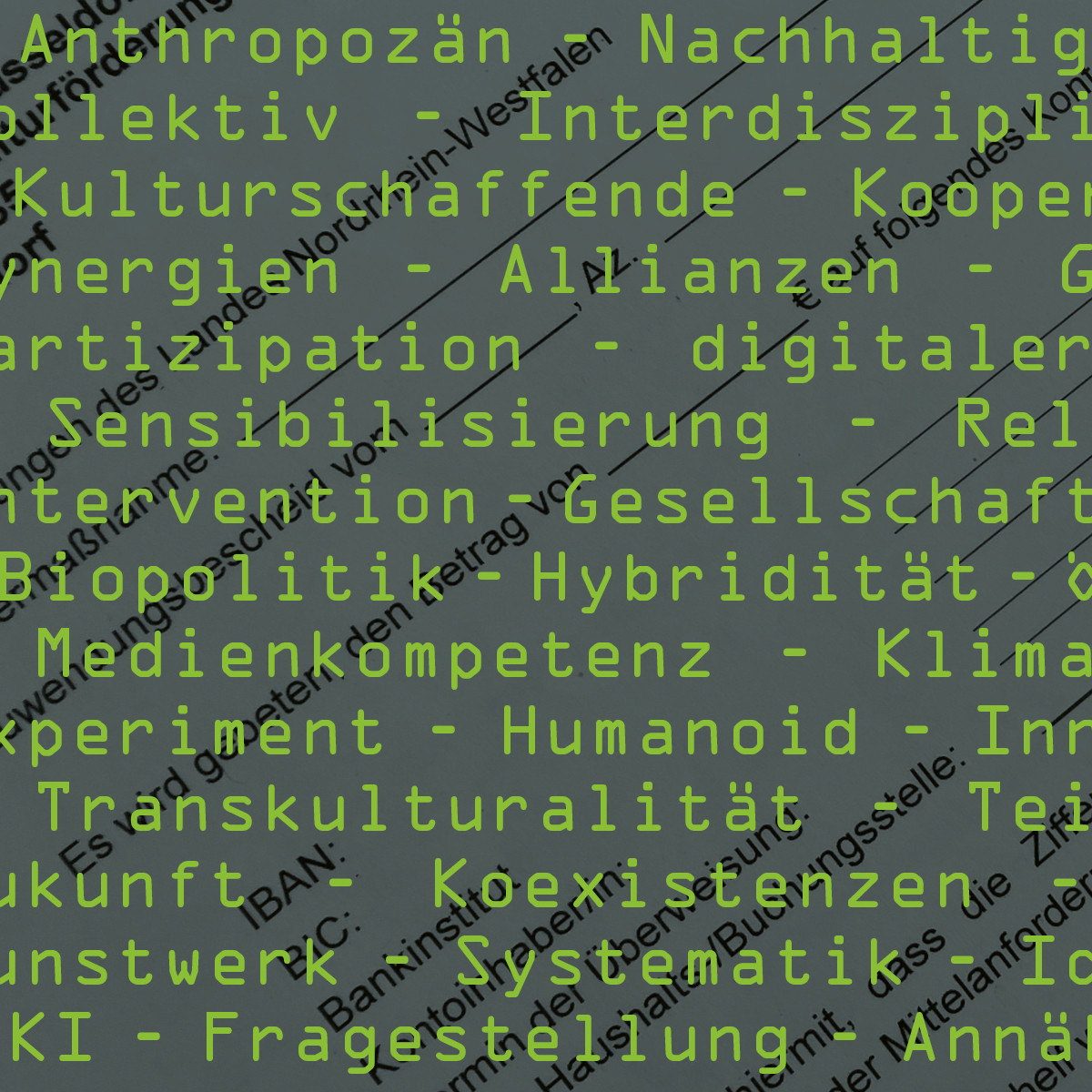Dokumentation
KUNST+NORM Sprachregeln des Kunstbetriebs

SUSANNE RISTOW: Herzlichen Dank für die freundliche Einladung und Einführung. Ich freue mich, diese beiden Kunstkritiker mit all ihrem kritischen Potenzial hier zusammentreffen zu lassen zu einem Thema, das mich schon immer sehr interessiert hat und von dem ich den Eindruck habe, dass es auch viele Künstlerinnen und Künstler in NRW beschäftigt. Das ist entscheidend für uns im Landesbüro. Wir gehören zum Kunsthaus NRW in Kornelimünster, sind aber die mobile Abteilung und deswegen auch mit der Mobilen Akademie (MobiLaB) heute Abend in Dortmund. Wir haben den Eindruck, dass Künstlerinnen und Künstler sich immer stärker bestimmten Sprachregeln des Kunstbetriebs ausgesetzt fühlen bzw. auch immer stärker diesen Sprachregeln entsprechen. Also frage ich diejenigen, die sich mit Sprache beschäftigen und es wissen müssen, ob das nur ein unbegründeter Verdacht ist? Gefragt habe ich ja schon mit dem Titel unserer Reihe MÖGLICHKEITSRAUM KUNST. Mit „Möglichkeitsraum“ habe ich einen Begriff benutzt, der eigentlich auch schon zu solchen sogenannten „Buzzwords“ gehört, also Schlagwörtern des Kunstbetriebs. Ist das nachvollziehbar für diejenigen, die über Kunst schreiben und die dann natürlich auch mit vielen Texten aus dem Kunstbetrieb konfrontiert werden?
Zu meiner Rechten, hier in der Mitte, findet sich Georg Imdahl, er schreibt für die FAZ, ist aber auch Professor für „Kunst und Öffentlichkeit“ an der Kunstakademie in Münster. Als ich ihn das erste Mal gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, diese Veranstaltung mit uns zu machen, sagte er: „Ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Thema so viel sagen kann.“ Aber wenn man schon über all diese Ausstellungen schreibt, muss man doch eigentlich auch im Thema sein? Ist man darüber nicht automatisch auch mit den Regeln der Sprache beschäftigt? Ich habe dann versucht, bei ihm selbst Sentenzen zu finden und habe interessanterweise keine solcher Begriffe gefunden. Ich kann ihm da nichts nachweisen. Mich würde natürlich in dem Zusammenhang – aber das machen wir dann gleich etwas ausführlicher, lieber Georg – auch interessieren, wie Deine Gespräche mit den Studierenden über die Rolle der Presse in der Arbeit zu Kunst und Öffentlichkeit verlaufen?
Gegenüber, am äußeren Rand der Bühne, sehen wir Wolfgang Ullrich. Wir haben uns in unseren Vorgesprächen schon sehr viel Gedanken zur Sprache der digitalen Kultur gemacht. Viele wissen wahrscheinlich, dass er die Reihe „Digitale Bildkulturen“ herausgibt, wo bestimmte Begriffe der Gegenwart ohnehin genauer untersucht werden. Insofern ist er natürlich besonders berufen, sich über möglicherweise neue Begriffe des Sprechens über Kunst, aber vielleicht tatsächlich auch über Sprachregeln Gedanken zu machen. In seinem neuesten Buch „Die Kunst nach dem Ende der Autonomie“ ist die Rede vom „neuen Verbund von Kunst, Mode, Design und Aktivismus“ und ich vermute, auch das spielt eine Rolle bei der Verbreitung immer ähnlicherer Begriffe. Diese Begriffe haben wir teils schon auf unserer Einladungskarte angedeutet. Und wer genau hinschaut und wer vielleicht hin und wieder mal einen Antrag stellen durfte als Künstlerin oder als Künstler fühlt sich auch direkt vom grauen Untergrund der Bürokratie beeinflusst….neben der Angabe meiner IBAN Nummer (wie hier im Bild) ist natürlich auch immer die Frage zu stellen: Wie formuliere ich eigentlich meinen Projekttext? Welche Schlagwörter sollten da möglicherweise vorkommen? Oder ist das nur vorauseilender Gehorsam? Das wäre jetzt die erste Frage an Euch.
GEORG IMDAHL: Wenn ich darf. Also erst mal vielen Dank für die Einladung. Mein anfängliches Zögern bezog sich auf die Antragsprosa, über die wir ja gesprochen haben, die kenne ich jetzt in der Tat nicht so wahnsinnig gut. Ich bin ja eher Rezipient als Produzent und sehe auch eher die Ergebnisse dessen, was gemacht wird. Befinden wir uns also in irgendwelchen Fesseln von normativ nicht niedergeschriebenen, aber so geltenden Regeln oder Begriffen?
Vielleicht erst mal ganz grundsätzlich zu den Begriffen, die du aufgeschrieben hast: „Anthropozän“, „Nachhaltigkeit“, „Perspektivenwechsel“ - da gibt es ja viele, zu denen uns positive Beispiele einfallen. Zu „Humanoid“ und „Experiment“ Ausstellungen hier im Hause im Hardware MedienKunstVerein, zu „Kollektiv“ und „Kooperation“ die Documenta. Oder zu „Biopolitik“ oder „Klimakrise“ habe ich gerade von Julian Charrière in der Langen Foundation in Neuss eine Ausstellung gesehen, seriös, fand ich interessant. Es können ja alle Künstlerinnen und Künstler selbst bestimmen, nach welchen Themen sie arbeiten wollen, wenn sie etwas zu sagen haben. Und wenn das, was dann an Kunst entsteht, gute Kunst ist, steht das immer für sich. Das deckt dann nicht nur irgendwelche gesellschaftlichen Begriffe ab, sondern ist, ich würde sagen, Herr Ullrich, autonom. „Autonomie“ ist ja auch ein Begriff, den Sie in die Debatte gebracht haben. Der Autonomiebegriff hat ja eine Wandlung erfahren. Autonomie war mal im 20. Jahrhundert konkrete Kunst, abstrakte Kunst, ungegenständliche Kunst, die mit der sichtbaren Welt nichts zu tun hat und vielleicht sogar im klassischen Sinn als Gegenentwurf wirkte. So eine Art von Autonomie interessiert uns nicht mehr. Aber wie schon immer gilt, dass gute Kunst für sich steht und sich auch durch diese Begriffe nicht auflösen lässt. Das heißt, sie lässt sich nicht einfach nacherzählen, sondern sie muss erlebt werden, um sie selbst sein zu können. Und dann ist auch hochpolitische Kunst autonom in dem Sinne, dass es erstmal künstlerische Setzungen sind. Ich habe zum Beispiel ein kleines Büchlein geschrieben über Santiago Sierra, das sind alles Performancearbeiten, die lassen sich hervorragend erzählen. Wenn man sie nicht gesehen hat, kann man trotzdem schlecht mitreden, würde ich sagen. Insofern ist Autonomie ein Begriff, der wichtig geworden ist. Können wir da ein bisschen Klärung herbeiführen, was Autonomie heute bedeuten soll? Können Sie vielleicht auch etwas dazu sagen? Sie haben den Begriff ja im Titel Ihres Buches aufgeführt.
WOLFGANG ULLRICH: Da sage ich gern gleich etwas zu. Vielleicht aber noch ein paar Sätze oder kurze Gedanken vorab, um unserem heutigen Abend noch einen kleinen Umraum zu geben. Das Thema, das wir heute diskutieren, ist einerseits sehr neu und aktuell, andererseits hat es natürlich auch eine sehr lange Tradition. Das Klagen über die Sprache, mit der über Kunst gesprochen und geschrieben wird oder die einfach in der Kunstwelt auch eigenen Raum hat. Da könnten wir in die Romantik zurückgehen, wo die Klagen sehr laut waren und zum Teil so heftig geführt wurden, dass etwa im Umkreis der Gebrüder Schlegel das Dogma Wolfgang Ullrich, Georg Imdahl, Susanne Ristow (Foto: Julia Zinnbauer)3 aufkam: Eigentlich dürfen nur Dichter sich über Kunst äußern, alles andere wird ihr nicht gerecht, jede profane, alltägliche Sprache, egal, von wem auch immer sie praktiziert wird.
Woran man ja auch eine unglaubliche Hochschätzung, Verehrung der Kunst sieht. Da wird fast schon in theologischen Kategorien gedacht. So, wie man eben in der Theologie oft auch der Meinung war, man kann nicht über Gott sprechen, das ist alles eigentlich schon blasphemisch, weil kein Wort dem gerecht wird, so wurde oft auch das Sprechen über Kunst sehr kritisch gesehen. Und insofern ist es schon ein Topos, zu klagen über die Sprache, die im Raum der Kunst gesprochen wird. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Moderne hindurch, vielleicht besonders im deutschsprachigen Raum. In den Sechzigerjahren bekannt geworden durch jemand wie Arnold Gehlen mit seinem Schlagwort der „Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst“, womit er einerseits konzediert, dass Kunst immer auch noch eine sprachliche Begleitung braucht, eskortiert werden muss durch Diskurse, aber andererseits die Art der Diskurse dann ganz schlimm findet und zu pathetisch. Er spricht vom „Ansingen der Kunst“. Ähnlich haben wir dann die Kritik auch noch in den 80er und 90er Jahren, wo jeder Katalogtext mit irgendeinem Derridazitat beginnen musste, oder? Es gab so vier, fünf Autoren, die immer zitiert wurden. Jetzt haben wir tatsächlich eine andere Phase und das ging gerade so ein bisschen durcheinander am Anfang:
Sprechen wir hier jetzt über die Sprache, mit der Dritte über Kunst sprechen, also Kritiker:innen, Kurator:innen, Theoretiker:innen oder so, oder sprechen wir über die Sprache, die die Künstler:innen selbst verwenden? Ich glaube, da sollte man auch noch mal zwischen beidem unterscheiden, was aber natürlich für viele, die heute über Kunst schreiben oder sprechen, zutrifft, und das wäre schon historisch neu: Das Schlagwort „Antragsprosa“ fiel gerade schon, natürlich ist der Kunstbetrieb mittlerweile auch ein sehr starker Drittmittelbetrieb geworden. Wir haben genau dasselbe Phänomen oder Problem in der Wissenschaft. Auch da ist die Antragsprosa ein sehr verbreitetes Genre geworden und da wird natürlich immer Rücksicht genommen auf Ausschreibungsbedingungen, da haben sich eigene Sprachspiele etabliert und eigene Begriffe, „Buzzwords“, wie du gesagt hast, sind da stark geworden. Es ist vielleicht schon so eine Signatur der Gegenwart, dass vieles auch in der Kunstwelt erst mal als Projekt existiert, als Antrag für eventuelle Geldgeber. Das betrifft Künstler:innen, die sich für ein Artist-in- ResidenceProgramm bewerben, genauso wie Kurator:innen, die die Gelder brauchen, um eine Ausstellung zu machen. Das gilt auch für viele feste Institutionen, die ja auch nicht mehr durchfinanziert sind, sondern jede Ausstellung neu finanzieren müssen, wieder neue Anträge schreiben müssen.
SR: Das wäre ein Punkt, über den man noch ein bisschen intensiver sprechen müsste, nämlich Projektmanagement. Das ist auch etwas, wonach ich immer wieder von Künstlerinnen und Künstlern gefragt werde. Trotzdem würde ich schon ganz gerne an der eben von Georg Imdahl gestellten Frage nach der Autonomie dran bleiben, denn das hat genau damit zu tun. Die Angewiesenheit auf Drittmittel und die Frage danach, ob es so etwas wie einen Auftraggeber gibt, ist in dem Zusammenhang wichtig.
(Weiterlesen im Pdf in der Infobox)